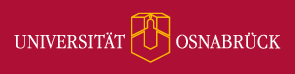Hauptinhalt
Topinformationen
Forschung
Laufende Projekte
Betreuung als Infrastruktur – Der Hort im Kontext von Ganztagsbetreuung
Während der Hort in der Erziehungswissenschaft und Kinder- und Jugendhilfe sowie Bildungspolitik über viele Jahre als Auslaufmodell im institutionellen Gefüge des Aufwachsens galt, erfährt er gegenwärtig u.a. im Kontext der aktuellen Implementierung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder eine neue Bedeutungszuschreibung und Anerkennung. Scheinbar kann der Hort als soziale Arena somit mit seinem aktuell nicht klar abgrenzbaren pädagogischen Profil eine organisationale Lücke zwischen Kinder- und Jugendhilfe und Schule füllen, die im Geflecht von Zuschreibungen, Erwartungen und historischen Entwicklungen zwischen Politik, föderaler Bildungsorganisation, kommunaler Sozialplanung und Eltern sowie Kindern entstanden ist. International gesehen ist der Hort als Organisationsform zwischen Schule und Kinder- und Jugendhilfe – und somit quer zum Bildungs- und Sozialsystem – dabei zwar spezifisch für das institutionelle Gefüge des Aufwachsens in Deutschland. Internationale Studien bieten aber durchaus Erkenntnisse zur Komplexität der Welfare Mixes in diesem Kontext der „extended education“.
Im beantragten Vorhaben wird der Hort darum als soziale Arena in der kommunalen Infrastruktur des institutionellen Gefüges der Betreuung analysiert. Es werden die Unschärfe des Begriffs „Hort“ und die unklaren Abgrenzungen zum Ausgangspunkt genommen, um empirisch zunächst die Erwartungshaltungen unterschiedlicher Akteur*innen, die wiederum verschiedenen Sozialen Welten angehören, in der Infrastruktur der Ganztagsbetreuung zu analysieren. Es ist das Ziel des Projektes über drei Case Studies in drei Städten bzw. Landkreisen in Deutschland die Legitimationsfiguren und die Funktionen des Hortes aus der Perspektive der sozialen Welten, die diesen vor Ort konstituieren, zu analysieren. Die Legimitationsfiguren von Horten sind angesichts der geringen fachlichen und institutionellen Verortung der Begründungslogiken und der Fachkräftekonstellationen vor Ort bearbeitungsbedürftig und werden in den jeweiligen sozialen Welten und in Verflechtung sowie Auseinandersetzung mit den anderen sozialen Welten alltäglich hergestellt. Für jede Case Study sind vier soziale Welten – Kinder, Familien, Fachkräfte, Verwaltung & Politik – zu untersuchen. In der Zusammenführung der drei Case Studies und den erfassten unterschiedlichen Legitimations- und Funktionskomplexen sollen übergreifende Figuren der Konstituierung des Horts als soziale Arena herausgearbeitet werden. In der komparativen Analyse soll zudem die Bedeutung der unterschiedlichen policy-Kontexte erfasst werden.
Kooperationspartner: Prof. Dr. Gunther Grasshoff und Prof. Dr. Wolfgang Schröer (beide Universität Hildesheim), Prof. Dr. Florian Eßer (Universität Osnabrück)
Laufzeit: 32 Monate ab 07/2024
Förderung: DFG
Abgeschlossene Projekte
Familiales und professionelles Feedback im Zusammenhang mit mathematischer Entwicklung bei 4-6 jährigen Kindern aus unterschiedlichen Sozialmilieus (Ethnografisch-rekonstruktive Teilstudie im Verbundprojekt)
Bereits in der frühen Kindheit zeigen sich im Lernbereich Mathematik Relationen zwischen sozialen Faktoren und Bildungsungleichheit, die sich auf Sozialisationserfahrungen zurückführen lassen. Bislang ist allerdings wenig darüber bekannt, welche Sozialisationserfahrungen hier welche Rolle spielen. Das Projekt untersucht daher Spielsituationen in unterschiedlichen Kontexten (Familie, Kindertagesstätte), die Kindern Gelegenheiten für informelles mathematisches Lernen bieten. Zentral für das Lernpotenzial dieser Situationen ist das Interaktionsverhalten der beteiligten Personen. Ergebnisse aus der Feedbackforschung zeigen, dass das erhaltene Feedback prädiktiv für die Leistungsentwicklung des Kindes ist. Zudem deuten Studienergebnisse darauf hin, dass die Form des Feedbacks, das Kinder erhalten, vom Bildungshintergrund der Familie abhängt: Kinder von Eltern mit höherem Bildungsgrad berichten ein höheres Ausmaß an förderlichem, prozessbezogenem Feedback als Kinder von Eltern mit niedrigerem Bildungsgrad.
Das Projekt besteht aus mehreren Teilstudien. Die quantitativ-korrelative Teilstudie I untersucht die Rolle des familialen und des professionellen Feedbacks der entsprechenden Bezugspersonen für die mathematische Leistungsentwicklung von Kindern unterschiedlicher Sozialmilieus. Die ethnografisch-rekonstruktive Teilstudie II fragt danach, wie die Feedbackformen in die allgemeinen Interaktionsstrukturen von ausgewählten Familien und Kindertagesstätten eingebettet sind und welche Differenz- bzw. Kontinuitätserfahrungen sich für die Kinder auf der Basis ihres sozioökonomischen Hintergrunds ergeben. Die quantitativ-experimentelle Teilstudie III untersucht, ob die Form des Feedbacks der frühpädagogischen Fachpersonen vom sozioökonomischen Hintergrund des Kindes abhängt. Im Transfermodul werden zentrale Ergebnisse zu förderlichem Feedback in mathematischen Spielsituationen mittels eines Coachingangebots für frühpädagogische Fachpersonen in Kooperation mit dem nifbe e. V. in die Praxis geleitet.
Laufzeit: 2019/02 – 2023/12
Projektleitung und Antragstellung (für die Teilstudie II): Prof. Dr. Dominik Krinninger, Prof. Dr. Hans-Rüdiger Müller
Mitarbeit: Sarah Böhme, Heike Einsiedler
Förderung: MWK/Nds.
Familiale Bearbeitung des Übergangs in die Grundschule
Das Projekt untersucht, welche Veränderungen in der Familie im Zusammenhang mit dem Übergang des ersten Kindes in die Grundschule auftreten. Es richtet dazu sein Augenmerk auf das Zusammenspiel von familialen Praktiken mit der Materialität der familialen Umgebung bei der Transformation des familialen Erfahrungsraums. Die interaktiven und kommunikativen Praktiken in der Familie sowie die Wohnräume der Familie einschließlich der dort arrangierten und gebrauchten Dinge werden ethnographisch daraufhin untersucht, welche neuen Themen, Praxisformen und Dinge in der Phase des Schuleintritts des ersten Kindes in der Familie auftreten und wie die neuen Erfahrungen in der Familie bearbeitet werden. Zum Einsatz kommen sowohl offene als auch fokussierte Erhebungsinstrumente wie leitfadengestützte Interviews mit Eltern und mit Kindern, Familiengespräche sowie videografische und fotografische Selbstdokumentationen. Die Untersuchung zielt darauf, empirisch fundierte Erkenntnisse über in der Familie auftretende Entgrenzungen zwischen Familie und Schule zu generieren, auch um auf dieser Grundlage nach den Bildungspotentialen zu fragen, die sich durch Differenzen und Übereinstimmungen zwischen diesen Lebensbereichen ergeben. Anhand der Reaktionen der Familie auf die sich ihr stellenden gesellschaftlichen Aufgaben und Erwartungen sollen schließlich auch pädagogisch relevante Formen der Reflexivität der Familie als Lebensgemeinschaft der Generationen empirisch erschlossen werden.
Laufzeit: 2014/09 - 2018/01
Projektleitung und Antragstellung: Dr. Dominik Krinninger
Mitarbeit: Kaja Keseelhut, M.A.; Richard Sandig, M.A.
Förderung: DFG (KR 3919/1-1)
Familie als kulturelles Erziehungsmilieu. Studien zum Bildungssinn familialer
Kulturerfahrungen am Beispiel des Spiels, des Fernsehens und der Familienmahlzeiten
Welche bildende Bedeutung hat die Familie als kulturelles Erziehungsmilieu? Wie lässt sich das kulturelle Anregungspotenzial einer Familie differenzieren? Vor dem Hintergrund der neueren Diskussion um informelle Bildungsprozesse und die Bedeutung der Familie für den Bildungsweg der Kinder wurden in ausgewählten Erfahrungsfeldern (Mahlzeiten, Spiel, Fernsehen) Familien als kulturelles Erziehungsmilieu rekonstruiert. Ein besonderer Schwerpunkt der Analysen liegt auf dem originären Bildungssinn der Familie, der sie gegenüber dem formal organisierten Erziehungs- und Bildungssystem als komplementäres Feld der Kulturvermittlung auszeichnet. Dementsprechend liegt dem Vorhaben ein Bildungsbegriff zugrunde, der nicht mit dem Begriff des Habituserwerbs (Bourdieu) identisch ist, sondern darüber hinaus nach der produktiven Nutzung der Spielräume fragt, die im sozialkulturellen Milieu einer Familie bestehen. Untersucht wurden im Sinne detaillierter Fallanalysen acht Familien, wobei als Datengrundlage Videoaufzeichnungen, Fotografien, Beobachtungsprotokolle, Gruppen- und Einzelinterviews sowie standardisiert erhobene, deskriptive Merkmale dienen. Der methodische Ansatz folgt der pädagogischen Ethnografie und verbindet im analytischen Vorgehen Strategien der rekonstruktiven
Sozialforschung mit hermeneutischen Ansätzen.
Laufzeit: 2008/07 - 2012/03
Projektleitung: Prof. Dr. Hans-Rüdiger Müller und Dr. Dominik Krinninger
Antragsteller: Prof. Dr. Hans-Rüdiger Müller (Förderjahre 1 und 2)
Prof. Dr. Hans-Rüdiger Müller und Dr. Dominik Krinninger (Förderjahr 3)
Förderung: DFG (MU 1450/5-1 und MU 1450/5-2)